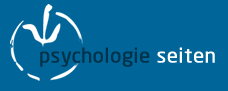Es gibt viele Theorien über das Entstehen der Emotionen. In meiner Arbeit werde ich exemplarisch drei evolutionspsychologische und vier kognitive Emotionstheorien vorstellen. Hierbei beleuchtet die Evolutionspsychologie die Phylogenese der Emotionen und geht dementsprechend der Frage auf den Grund, wie es kommt, dass wir Menschen Emotionen besitzen. Die Kognitionspsychologie beschäftigt sich mit der Aktualgenese der Emotionen. Sie versucht also zu klären, welche intraindividuellen Prozesse durch eine emotionsauslösende Situation angestoßen werden.
Evolutionspsychologische Emotionstheorien
Charles Darwin
1872 veröffentlichte Charles Darwin seine Emotionstheorie „The Expression of the Emotions in Man and Animals“. Sein Ziel war es zu beweisen, dass seine altbekannte Hypothese, der Mensch stamme vom Affen ab, auch bezüglich der Emotionen zutrifft. Diese definiert er als „bewusste mentale (psychische) Zustände von Personen und von höheren Tieren, wie zum Beispiel Furcht, Wut, Traurigkeit und Überraschung“, die durch „Einschätzungen und Bewertungen von Objekten, Situationen oder Ereignissen“ entstehen.
Zum Untersuchungsgegenstand machte er den mimischen Emotionsausdruck, der seiner Ansicht nach ebenso vererbt ist, wie die Fähigkeit, ihn zu deuten. Unter Zuhilfenahme von sechs verschiedenen Vergleichsmethoden prüfte Darwin den Emotionsausdruck auf Universalität. Zunächst wies er nach, dass sich Menschen innerhalb einer Kultur darüber einig sind, welcher Gesichtsausdruck welche Emotion vermittelt. Dass dies auch kulturübergreifend gilt, konnte er anhand der Berichte von Missionaren oder Kolonialbeamten zeigen, die die gleichen Mimiken bei zivilisationsferneren Kulturen beobachtet hatten. Um zu verdeutlichen, dass der Emotionsausdruck nicht auf soziale Lernprozesse zurückzuführen sein kann, untersuchte er zudem Kleinkinder sowie ein taubblind geborenes Mädchen, die ebenfalls die gleichen mimischen Ausdrucksweisen wie Erwachsene an den Tag legten. Zusätzlich ließ sich dies auch auf Geisteskranke übertragen, die, ebenso wie Kinder, deshalb untersucht wurden, da bei ihnen davon auszugehen ist, dass sie ihre Emotionen vergleichsweise unverfälscht ausdrücken. Besonders einschlägig ist schließlich die Tatsache, dass sich selbst bei Affen deutliche Ähnlichkeiten zur menschlichen Mimik beobachten ließen, was natürlich Darwins Evolutionstheorie unterstreicht.
Interessanterweise führt Darwin die Bestätigung seiner Hypothese jedoch nicht auf das von ihm entwickelte Selektionsprinzip zurück. Stattdessen beruft er sich im Rahmen des Prinzips der zweckmäßig assoziierten Gewohnheiten auf die Theorie Lamarcks von 1809, der zufolge erworbene Eigenschaften von Organismen durch diese weitervererbt werden können. Darwin geht davon aus, dass unsere entfernten Vorfahren ihre Emotionen ursprünglich willkürlich und bewusst ausdrückten, um damit ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Werden etwa die Augen bei Überraschung geweitet, so hat dies den Effekt, dass man unerwartete Reize möglichst schnell und effektiv wahrnehmen und somit hinsichtlich ihrer Gefährlichkeit einschätzen kann. Da solche Verhaltensweisen sich nun aufgrund ihrer Zweckmäßigkeit häufig wiederholten, entwickelte sich daraus eine Gewohnheit, d.h. nach einiger Zeit liefen die Verhaltensprozesse unbewusst ab. Den Grund hierfür sieht Darwin in einer Veränderung der an diesem Verhalten beteiligten Neuronenstruktur, die dann wiederum an die Nachkommen weitergegeben wurde. Analog hierzu soll auch die Fähigkeit zum Erkennen von Emotionen vererbt worden sein.
Was die Funktion des Emotionsausdrucks angeht, so hat diese nach Darwin eine organismische und eine kommunikative Komponente. Dabei definiert er die Funktion als diejenigen Wirkungen innerorganismischer Mechanismen, aufgrund derer in der Evolution selektiert wurde.
Die organismische Funktion kann, wie oben, etwa in der Optimierung der Informationsaufnahme bestehen. Allerdings kommt auch eine gefühlsregulierende Wirkung hinzu; d.h. Emotionen können durch ihren Ausdruck verstärkt und auch abgeschwächt werden.
Die kommunikative Funktion besteht darin, Artgenossen über die eigene Gefühlslage, aber auch über Gedanken, Wünsche und Handlungsabsichten zu informieren. So erhalten diese die Möglichkeit, bezüglich ihres eigene, reaktiven Verhaltens zwischen Kooperation und Opposition zu wählen. Kooperation kommt insbesondere durch Mitgefühl zustande. Allerdings weist Darwin der kommunikativen Funktion des Emotionsausdrucks eine untergeordnete Position zu, da er der Überzeugung ist, dass jede Ausdrucksbewegung ursprünglich einem eigenen, von der Kommunikation unabhängigen Zweck gedient haben muss.
William MacDougall
MacDougalls Emotionstheorie ist sozusagen in seine Instinkttheorie von 1908 eingebettet. Deshalb lohnt es sich an dieser Stelle, sie zumindest zum Teil darzustellen.
Eine Instinktreaktion ist laut MacDougall eine Gesamtreaktion des Organismus, die aus einer kognitiven, einer affektiven und einer konativen bzw. motivationalen Komponente besteht und dementsprechend afferente, zentrale und efferente Teilprozesse umfasst. Der Instinktprozess beinhaltet das Erkennen eines Objekts – wobei wohlgemerkt auch ein Individuum als „Objekt“ dienen kann – (kognitive Komponente), ein bestimmtes Fühlen bezüglich dieses Objekts (affektive Komponente) und schließlich ein inneres Streben hin zu oder weg von diesem Objekt (konative Komponente). Eine Instinktreaktion äußert sich in Verhalten, sie wird durch psychophysische Prozesse vermittelt und ihre grundlegende Voraussetzung ist eine bestimmte Verhaltensdisposition – sie ist es, was MacDougall eigentlich als Instinkt bezeichnet. Die Verhaltensdispositionen bzw. die ihnen zugrunde liegenden mentalen Strukturen eines Individuums betrachtet er als angeboren. Dies ist also der Grund, weswegen diese Theorie zu den evolutionspsychologischen zu zählen ist.
Die zentral erzeugten innerorganismischen Veränderungen als Reaktion auf den afferenten Teilprozess der Instinktreaktion werden im Bewusstsein quasi durch bestimmte emotionale Qualitäten repräsentiert. Diese nennt MacDougall Primäremotionen. Sie entstehen auf der Grundlage der sogenannten Hauptinstinkte für Flucht, Zurückweisung, Neugier, Kampf, Dominanz, Unterordnung und elterliche Fürsorge. Die entsprechenden Emotionen wären – in derselben Reihenfolge - Furcht, Ekel, Staunen, Ärger, Hochgefühl, Unterwürfigkeit und Zärtlichkeit. Die mit den Nebeninstinkten (z.B. Reproduktionsinstinkt, Erwerbsinstinkt, Konstruktionsinstinkt und Herdeninstinkt) verbundenen Emotionen sind, so MacDougall, vergleichsweise nicht so intensiv und schwerer differenzierbar.
Sekundäremotionen (oder auch: komplexe Emotionen) sind Mischungen aus mehreren Primäremotionen, aus denen eine neuartige Erlebnisqualität hervorgeht. Diese Idee lässt sich mit dem Konzept der Farbmischung gut vergleichen. Aus den Primäremotionen Staunen und Unterwürfigkeit ergibt sich zum Beispiel die Sekundäremotion Bewunderung und die Sekundäremotion Ehrfurcht setzt sich zusammen aus den drei Primäremotionen Staunen, Unterwürfigkeit und Furcht. Damit komplexe Emotionen auftreten können, müssen Objekte mehr als eine Primäremotion gleichzeitig auslösen können, wodurch besonders differenzierte Information über die betreffenden Objekte vonnöten ist. Diese wird vorwiegend durch Lernprozesse erworben, was impliziert, dass mit zunehmendem Alter immer mehr sekundäre Emotionen auftreten. Beispielsweise kann ein Kind gegenüber seinem ersten Schulbesuch zunächst Neugier empfinden, zu der sich über die Jahre hinweg unter Umständen aber auch Furcht und Unterwürfigkeit gesellen kann. Komplexe Emotionen setzen also meistens nicht nur angeborene, sondern auch erworbene emotionale Dispositionen voraus.
Die Emotionen, die weder primär noch komplex sind, nennt MacDougall abgeleitete Emotionen. Diese umfassen Freude, Hoffnungslosigkeit, Kummer, Zuversicht, Hoffnung, Angst, Verzweiflung, Enttäuschung, Bedauern und Reue. Sie widerspiegeln die affektiven Reaktionen einer Person auf den vermuteten oder wahrgenommenen Erfolg oder Misserfolg bei der Ausführung eines Handlungsimpulses (von diesem „leiten sie sich ab“). Die bewusste Repräsentation eines solchen Handlungsimpulses wird als Streben oder Wunsch bezeichnet. Abgeleitete Emotionen setzen also höher entwickelte kognitive Fähigkeiten voraus, nämlich Handlungen antizipieren und die Wahrscheinlichkeit eines Erfolgs oder Misserfolgs abschätzen zu können. Es gibt prospektive und retrospektive abgeleitete Emotionen: die prospektiven leiten sich von bestehenden Handlungsimpulsen ab, die retrospektiven bewerten bereits vergangene Handlungen. Die Funktion abgeleiteter Emotionen besteht darin, die aktuell wirksamen Handlungsimpulse zu regulieren, indem sie durch Zugabe von Lust bzw. Unlust verstärkt oder abgeschwächt werden.
Auch den Emotionen generell kommt laut MacDougall eine Regulationsfunktion zu. Die Handlungsimpulse, die wir wahrnehmen, lassen uns nur ein mehr oder weniger starkes „Gedrängtsein“ spüren, eine noch ungerichtete Triebenergie. Erst durch die Emotionen erhalten wir Informationen über die Qualität unserer aktuellen Antriebslage. Diese Informationen sind die Grundlage für jegliche Kontrolle, denn man muss sich schließlich dessen bewusst sein, was man beeinflussen will.
Abb. 1: Modelldarstellung der Emotionen nach R. Plutchik
Textfeld: Abb. 1: Modelldarstellung der Emotionen nach R. PlutchikIn deutlicher Anlehnung an MacDougall veröffentlichte Robert Plutchik 1958 seine Emotionstheorie, die im Wesentlichen eine vereinfachte Version der Theorie MacDougalls darstellt (zum Beispiel beschäftigt er sich nicht mit abgeleiteten Emotionen). Trotzdem ist die von ihm geprägte Modelldarstellung der Emotionen (siehe Abb. 1) so bekannt, dass ich sie hier anführen möchte.
Plutchik konzipiert einen umgekehrten Kegel, auf dessen „Bodenfläche“ die – ihm zufolge – acht Primäremotionen, segmentweise unterteilt, zu finden sind. Diese differenzieren sich aus, sodass die jeweilige Emotion zur „Kegelspitze“ hin an Intensität abnimmt. Zwischen zwei Kreissegmenten liegt jeweils die Sekundäremotion, die sich aus den beiden benachbarten Kreissegmenten ergeben würde.
Norbert Bischof
Norbert Bischof vertritt allgemein die These, die Psychologie solle sich mehr an der Biologie, insbesondere an der Evolutionstheorie orientieren. Sein Zürcher Modell der sozialen Motivation von 1993 umfasst sämtliche Motive, die ein Individuum in der Interaktion mit der Umwelt und anderen Individuen antreiben können. Der evolutionspsychologische Aspekt besteht darin, dass das Zürcher Modell quasi eine differenzierte Version von ähnlichen Motivations- bzw. Verhaltensmodellen darstellt, die bereits auf tierischer Ebene vorliegen. Die darin verankerten Mechanismen haben sich also offenbar der Selektion gegenüber durchgesetzt. Bischofs Emotionstheorie stellt angesichts der Komplexität des Zürcher Modells nur einen kleinen Teilaspekt davon dar, den ich hier aufgrund seiner Plausibilität dennoch nicht unerwähnt lassen möchte.
Eine wesentliche Rolle im Zürcher Modell spielt der sogenannte Coping-Apparat, dessen Aufgabe darin besteht, eine oder mehrere Lösungen für Situationen zu finden, in denen (Handlungs-)Antriebe aufgrund von Barrieren nicht ausagiert werden können. Ein Beispiel wäre etwa ein akutes Hungergefühl während einer Prüfung. Auf die verschiedenen Arten von Coping möchte ich an dieser Stelle nicht eingehen, da dies am eigentlichen Thema, den Emotionen, vorbeigeht.
Letztere haben nach Bischof die Aufgabe, dem Coping-Apparat darüber zu informieren, „dass, wofür und wie lange er sich einzuschalten hat, wenn ein Antrieb auf eine Barriere stößt“. Negative Emotionen sind also die innerorganismische Informationswährung, die den Coping-Apparat zum Handeln auffordert.
Auch positive Emotionen lassen sich sinnvoll in das Zürcher Modell integrieren. Sie melden ihrerseits dem Coping-Apparat zurück, dass ein bestimmtes Problem gelöst bzw. ein bestimmtes Bedürfnis erfüllt worden ist, damit dieser die Zielverfolgung einstellen und seine Ressourcen zur Lösung anderer Aufgaben aufwenden kann. Dies begründet Bischof mit der Forschungsarbeit von Bluma Zeigarnik, die 1927 zeigen konnte, dass erledigte Aufgaben schlechter im Gedächtnis bleiben als unerledigte Aufgaben. Bischof vermutet auf dieser Grundlage, dass der Coping-Apparat nach Erledigung einer Aufgabe die für sie erforderlichen Informationen aus seinem System löscht.
Kognitive Emotionstheorien
In der Emotionspsychologie zeichnet sich eine klare Entwicklung vom Physikalismus hin zum Kognitivismus ab, die anhand der folgenden von mir gewählten Theorien gut ersichtlich wird. Beginnen möchte ich mit der Theorie von William James, die an sich noch nicht als kognitionspsychologisch zu bezeichnen ist, kognitivistischen Denkansätzen jedoch eine gute Starthilfe gab.
William James
Bezeichnend für James‘ Emotionstheorie von 1884 ist der Leitsatz: „Wir weinen nicht, weil wir traurig sind, sondern wir sind traurig, weil wir weinen“. Er geht davon aus, dass die Wahrnehmung von Umweltereignissen automatische viszerale Reaktionen nach sich ziehen. Die bewusste Wahrnehmung dieser viszeralen Reaktionen durch das Individuum ist bereits dessen Emotion. Höhere Kognitionen spielen hier keine Rolle.
Hieraus ergibt sich automatisch die Annahme, man könne Emotionen auch künstlich erzeugen, die Gregorio Marañon überprüfte.
Gregorio Marañon
1924 injizierte Marañon seinen Versuchspersonen Adrenalin und beobachtete ihre darauf folgenden Reaktionen. Hierbei verließ er sich hauptsächlich auf Selbstberichte. 70% der Versuchspersonen gaben an, körperliche Empfindungen zu haben, die für gewöhnlich mit emotionalem Erleben einhergehen. Jedoch ist anzumerken, dass sie durchaus in der Lage waren, zwischen körperlichem und emotionalem Erleben zu unterscheiden, was an ihren im Konjunktiv formulierten Aussagen zu sehen ist, z.B. „Es ist, als ob ich Angst hätte“. 30% der Versuchspersonen gaben an, tatsächlich Emotionen zu erleben bzw. durch die körperlichen Empfindungen plötzlich an bestimmte Lebensereignisse erinnert worden zu sein, in denen sie dieselben körperliche Erregung gespürt haben. Indem Marañon in einer späteren Versuchsreihe seinen Versuchspersonen Gedanken an kummerbehaftete Sachverhalte oder Erinnerungen nahelegte, schaffte er es schließlich, Emotionen gezielt hervorzurufen.
Marañon schloss aus seinen Befunden, dass physiologische Erregung für das Erleben von Emotionen zwar notwendig, jedoch nicht hinreichend sei. Eine zweite Komponente, nämlich das Erleben bestimmter Kognitionen, käme ebenfalls hinzu. Hiermit war also der Grundstein für kognitive Emotionstheorien gelegt.
Stanley Schachter
Die Emotionstheorie Schachters postuliert folgende Bedingungen für das Entstehen von Emotionen: Das Individuum die durch ein auslösendes Ereignis verursachten physiologischen Veränderungen in seinem Körper wahr und führt sie zusätzlich kausal auf das auslösende Ereignis zurück. Dieses muss dabei vom Individuum in emotionsrelevanter Weise eingeschätzt worden sein. Die physiologische Erregung ist lediglich für die erlebte Intensität der Emotion von Bedeutung, die Qualität der Emotion hingegen hängt von der Kognition, also der Situationseinschätzung, ab.
In dem 1962 von Schachter und Singer durchgeführten Experiment, wurde diese Theorie mittels der Methode der Fehlattribution untersucht. Analog zu Marañon wurde den Versuchspersonen verdeckt Adrenalin injiziert, woraufhin diese eine zunächst unerklärliche körperliche Erregung verspürten und mittels eines Fragebogens nach ihrem emotionalen Befinden befragt wurden. Schachter nahm an, dass die Versuchspersonen aufgrund ihrer körperlichen Erregung auf die Suche nach möglichen Ursachen gehen und in den meisten Fällen eine mehr oder weniger plausible emotionale Ursache finden würden. Diese sollte dann die erlebte Emotion auf den Plan rufen, und zwar je nach Einschätzung der Situation eine andere. Mit diesem Design ließe sich die Bedeutung der kognitiven Komponente gut nachweisen, allerdings betont Schachter, dass dieser Ablauf nicht dem üblichen entspricht, da sich im Alltag eine Erklärung für eine erlebte körperliche Erregung meist unmittelbar aus der Situation ergebe.
Nur ein Teil der angenommenen Unterschiede zwischen den verschiedenen Versuchsgruppen erwies sich als statistisch bedeutsam. Zudem waren auch die signifikanten Mittelwertsunterschiede an sich relativ gering. Aufgrund dessen habe ich an dieser Stelle auf deine detailliertere Darstellung des Experiments verzichtet. In der Kognitionspsychologie erfreut sich Schachters Theorie dennoch eines hohen Stellenwerts.
Bernard Weiner
Während Schachter nicht genau spezifizierte, welche Kognitionen genau welche Emotionen hervorrufen, liegt hier der Fokus von Weiners Attributionstheorie von 1995.
Der Prozess der Emotionsentstehung besteht nach Weiner aus drei Schritten. Am Anfang steht die Tatsachenüberzeugung, also die Überzeugung des Individuums, „dass ein Ereignis eingetreten ist; oder allgemeiner, dass ein Sachverhalt vorliegt“. Anschließend wird dieses Ereignis bzw. dieser Sachverhalt vom Individuum bewertet und zwar in Bezug darauf, inwieweit dadurch ein angestrebtes Ziel erreicht oder nicht erreicht wird. Schließlich sucht das Individuum nach den Ursachen für das Ereignis, allerdings auch nur dann, wenn es unerwartet, negativ oder von hoher persönlicher Bedeutung ist.
Hierbei ist nicht die eigentliche Ursache von Bedeutung, sondern ihre Einordnung auf den drei Attributionsdimensionen stabil/variabel, internal/external und kontrollierbar/unkontrollierbar. Aus der Interaktion von Bewertung und Ursachenzuschreibung entstehen schließlich die Gefühle. Zum Beispiel entsteht Stolz durch die internale Attribution eines positiv bewerteten Ereignisses oder Hilflosigkeit durch die stabile Attribution eines negativ bewerteten Ereignisses.
Hier spielt die Physiologie bei der typischen Emotionsgenerierung so gut wie keine Rolle mehr. Bei Weiner zählt der Leitsatz: „Wie wir denken, beeinflusst wie wir fühlen“. Er merkt dennoch an, dass nicht alle Emotionen auf der Basis von Kognitionen verstehen. Ausnahmen seien z.B. konditionierte Angst oder hormonell bedingte affektive Störungen.
An den Schluss meiner Arbeit möchte ich einen kurzen Abriss aller dargestellter Theorien stellen, um für Überblick zu sorgen.
Charles Darwin konzentrierte sich auf die Universalität des Emotionsausdrucks, den er als vererbt betrachtet. Allerdings beruft er sich bei der Erklärung dieses Sachverhaltens nicht auf die Selektionstheorie, sondern auf das Prinzip der zweckmäßig assoziierten Gewohnheiten von Lamarck.
William MacDougall betrachtet Emotionen als „Begleiterscheinung“ von Instinktprozessen, die uns angeboren sind. Seine Klassifikation in primäre und sekundäre Emotionen wurde auch von Robert Plutchik aufgegriffen.
Norbert Bischof integriert die menschlichen Emotionen in sein Zürcher Modell, indem er ihnen die Aufgabe zuweist, mit dem Coping-Apparat zu kommunizieren, um dessen Effizienz zu optimieren.
In der Emotionspsychologie ist eine klare Tendenz in Richtung Kognitivismus zu verzeichnen. Während William James die Physiologie als zentrale Ursache der Emotionen sieht, zeigen Marañons Befunde auf, dass auch eine zweite, kognitive Komponente hinzuzuziehen ist. Stanley Schachter zeigt mit seiner Arbeit auf, dass die Unterschiedlichkeit der Emotionen eben gerade von diesen Kognitionen abhängt. Schließlich spezifiziert Bernhard Weiner, welche Kognitionen welche Emotionen hervorrufen.